Haftung im Ehrenamt:
- Joost Schloemer (Admin)
- 12. Juni 2025
- 2 Min. Lesezeit
Haftung im Ehrenamt: Was § 31a und § 31b BGB für Vereine bedeuten
Das ehrenamtliche Engagement ist das Rückgrat vieler Vereine – ohne die freiwillige Mitwirkung unzähliger Menschen wäre das Vereinsleben kaum vorstellbar. Doch mit Verantwortung kann auch rechtliches Risiko einhergehen.
Um dieses Risiko für Ehrenamtliche zu minimieren, sieht das Bürgerliche Gesetzbuch in den §§ 31a und 31b BGB besondere Haftungsprivilegien vor. Diese schaffen Sicherheit – für Einzelne wie für die Vereinsorganisation insgesamt.
§ 31a BGB: Schutz für Vereinsorgane und besondere Vertreter
Der § 31a BGB bezieht sich auf ehrenamtlich tätige Organmitglieder (etwa Vorstände) sowie auf besondere Vertreter im Sinne des § 30 BGB. Sie haften dem Verein gegenüber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ein Missgeschick oder eine einfache Nachlässigkeit führt demnach nicht automatisch zur persönlichen Haftung. Diese gesetzliche Regelung stärkt das Vertrauen in die ehrenamtliche Mitwirkung und soll Hemmschwellen abbauen, ein Vorstandsamt zu übernehmen.
§ 31b BGB: Haftungsbegrenzung auch für aktive Mitglieder
Auch für einfache Vereinsmitglieder, die unentgeltlich oder gegen eine Aufwandsentschädigung bis 840 Euro jährlich tätig werden, gilt eine vergleichbare Haftungsregel. Verursacht ein Mitglied bei der Wahrnehmung satzungsgemäßer Aufgaben einen Schaden, so haftet es gegenüber dem Verein ebenfalls nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Damit schützt der Gesetzgeber auch engagierte Helfer:innen bei Veranstaltungen, in Arbeitsgruppen oder in der Vereinsverwaltung.
Wichtig: Innenverhältnis versus Außenverhältnis
Die Haftungsprivilegien greifen ausschließlich im Innenverhältnis – also im Verhältnis zwischen den ehrenamtlich Tätigen und dem Verein selbst. Dritte (z. B. Geschädigte außerhalb des Vereins) können sich darauf nicht berufen. Kommt es zu einem Schaden gegenüber Außenstehenden, kann der Verein – und je nach Konstellation auch das handelnde Mitglied – grundsätzlich haftbar gemacht werden.
Pflicht zur Freistellung bei leichter Fahrlässigkeit
Erleidet ein Organmitglied im Rahmen seiner Tätigkeit wegen leichter Fahrlässigkeit einen finanziellen Nachteil (z. B. durch Schadensersatzforderungen Dritter), ist der Verein gesetzlich verpflichtet, dieses Mitglied von den Verbindlichkeiten freizustellen. Diese Freistellungspflicht entfällt nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Gestaltungsspielraum in der Satzung
Vereine haben die Möglichkeit, die Haftungsregelungen über die Satzung weiter abzusichern. So kann z. B. der Haftungsausschluss für grobe Fahrlässigkeit vorgesehen werden – solange dies nicht zu Lasten der geschützten Personen geht. Eine solche Erweiterung kann insbesondere für besonders risikobehaftete Tätigkeiten (z. B. Sportgerätewartung, Veranstaltungsleitung) sinnvoll sein.
Fazit: Gesetzliche Privilegien gezielt nutzen
Die §§ 31a und 31b BGB sind mehr als bloße Formalien – sie sind ein zentrales Instrument zur Förderung des Ehrenamts. Sie reduzieren individuelle Haftungsrisiken, erhöhen die Planungssicherheit für Vereine und ermöglichen eine verantwortungsvolle Arbeitsteilung. Jeder Verein sollte diese Vorschriften kennen – und durch geeignete Satzungsregelungen und Versicherungen flankieren.
Tipp für Vereine: Prüfen Sie Ihre Satzung auf mögliche Ergänzungen zur Haftung. Und stellen Sie sicher, dass Ihre Vereinsversicherung auch im Außenverhältnis schützt – besonders bei Veranstaltungen, Bauvorhaben oder Publikumsverkehr.

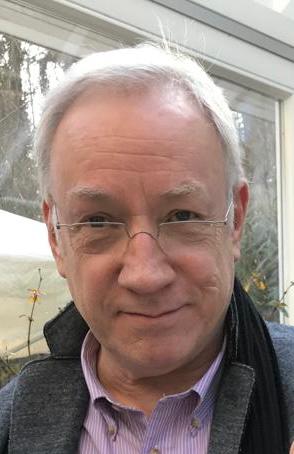




Kommentare